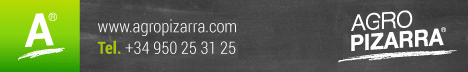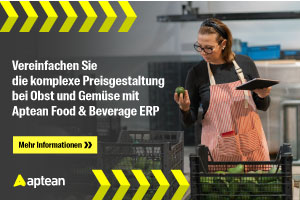„Ackerflächen bislang in perfektem Zustand“ Österreich: Saisonstart für Gemüse - Frische, Farbe und Genuss am Teller
Nach einem sehr trockenen Winter und vielen vergleichsweise warmen Tagen Ende Februar und im Monat März waren die Anbaubedingungen für das OÖ Frischgemüse in diesem Frühjahr im Freiland optimal, berichtet das Agrarische Informationszentrum (AIZ).

Bildquelle: Pixabay
Die Ackerflächen konnten bislang im ganzen Bundesland in perfektem Zustand und zur geplanten Zeit bearbeitet werden. Seit Mitte Februar erfolgen Saaten und Pflanzungen nach ihrem exakten „Anbauplan“ und so können viele Gemüsearten wie z.B. Radieschen, Salate, Jungzwiebel, Kohlrabi und vieles mehr bereits jetzt in besten Qualitäten und in großen Mengen an den Lebensmittelhandel (LEH) geliefert werden.
„Der abwechslungs- und vitaminreiche Genuss fördert nun wieder Lebensfreude und Wohlbefinden bei den Konsumentinnen und Konsumenten.“
Beim Gemüse-Saisonauftakt (v.l.): Ewald Mayr, Obmann GEO_OÖ, Mag. Franz Waldenberger, Präsident der LK OÖ, Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger und Gemüsebauer Karl Hofer. (Foto © Landwirtschaftskammer OÖ)
„Der erwerbsmäßige landwirtschaftliche und gärtnerische Gemüseanbau wird in Oberösterreich 2025 von 175 Betrieben auf einer Gesamtanbaufläche von etwa 2.059 Hektar betrieben. Damit reduziert sich gegenüber dem Vorjahr die Betriebsanzahl der Gemüseproduzenten um vier Betriebe. Die Anbaufläche hingegen steigt erfreulicherweise nach ersten Erhebungen dieses Jahr (nach Rückgängen 2023 und 2024) wieder kräftig um ca. 111 Hektar an“, beschreibt Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, die Struktur im heimischen Gemüseanbau.
Für die Saison 2025 werden bei den rund 80 verschiedenen Gemüsearten ca. 85.000 Tonnen Erntemenge mit einem Gesamtproduktionswert von ca. 38 Millionen Euro erwartet.
Bildquelle: Pixabay
Bio-Gemüse-Anteil erreicht 2025 in OÖ erstmals die historische Marke von 30 Prozent
Der flächenmäßige Anteil des biologisch produzierten Gemüses nimmt weiter kontinuierlich leicht zu und erreicht in Oberösterreich mit 618 Hektar Anbaufläche für alle Gemüsekulturen im Erwerbsanbau erstmals einen Anteil von 30 Prozent der Jahresgesamtproduktion. Die restliche Gemüseanbaufläche von 70 Prozent wird nach den Kriterien der kontrollierten AMA-GAP-Produktion bestellt.
Die Aufteilung Frischgemüse – Sauergemüse (Vertragsproduktion) beträgt rund 80 Prozent zu 20 Prozent und entwickelt sich immer stärker in Richtung Frischgemüse. Um den für den Gemüseanbau wichtigen Fruchtfolgewechsel durchführen zu können, wird ca. 64 Prozent des Gemüses auf Pacht- bzw. Tauschflächen angebaut. „Einzelne Gemüsebaubetriebe findet man praktisch auf alle Bezirke in OÖ verteilt, jedoch macht der Anteil des Bezirkes Eferding rund die Hälfte des OÖ Gemüseanbaus aus“, so Waldenberger.
Die Zunahme der Gemüseanbaufläche 2025 hat unterschiedlichste Ursachen
Das Marktumfeld für biologisches Gemüse ist derzeit positiv, sodass Lebensmittelhandel und die Verarbeitungsindustrie Abnahmegarantien bieten. Wermutstropfen ist, dass die Spannen geringer werden.
2024 gab es hohe Ertragsausfälle. Ursachen waren Hitze, Wassermangel, Überschwemmung nach Starkregen, überdurchschnittlich hohe Verlust durch Wildverbiss sowie Qualitätsverluste durch nicht wirksame bzw. weggefallene Pflanzenschutzmittelwirkstoffe. Diese Verluste dürfen sich bei einem Lieferanten für den Lebensmitteleinzelhandel nicht wiederholen, weshalb 2025 die Anbauflächen aus Sicherheitsgründen leicht erhöht wurden – trotz gleichbleibender Abnahmemengen.
Die Zuckerrübenfläche ist aufgrund gekürzter Kontrakte innerhalb eines Jahres in Österreich um ca. 16.000 Hektar, in OÖ um ca. 3.500 Hektar zurückgegangen. Diese spezialisierten Ackerbauern mussten innerhalb weniger Wochen eine rentable pflanzenbauliche Alternative suchen. Einige versuchen es erstmals oder wieder mit Gemüse oder auch Erdäpfeln.
Entwicklung einzelner Gemüsearten
Bei den Hauptgemüsearten über 60 Hektar Anbaufläche lässt sich erkennen, dass die Kultur Zuckermais in den letzten Jahren zur weitaus flächenstärksten Einzelgemüseart in OÖ geworden ist. Eine Änderung des Konsumverhaltens, der Zubereitung (Grillgemüse) und eine relativ einfache Kultivierung (maschinelle Ernte, keine Beregnung erforderlich) machten das möglich.
So wie auch Speisekürbis, Salatgewächse, Kraut, Einlegegurken, Karotten und Rote Rüben hat Zuckermais eine hohe wirtschaftliche Bedeutung und macht im Jahr 2025 mit 404 Hektar Anbaufläche bereits 19,6 Prozent der Gesamtgemüsefläche aus. Ebenso im Steigen begriffen sind die Flächen für Wurzelgemüse wie Karotten und Rote Rüben. Flächen für Sauergemüse (Sauerkraut, Einlegegurken) gehen aufgrund des Ernährungstrends hin zu mehr Fruchtgemüse zurück.
Bei den Gemüsearten unter 60 Hektar Anbaufläche in OÖ sieht man, dass die Anbauflächen bei Kulturen mit wachsendem Bioanbau (Zucchini, Radieschen, Porree) zunehmen. Leider konnte sich der Knoblauchanbau für den LEH in OÖ durch die hohen Arbeitskräftekosten nicht langfristig behaupten, weshalb die Flächen wieder zurückgehen.
„Beim Bierrettich ist man aufgrund einer neuen Pflanzenschutzstrategie und moderner Hackgeräte zuversichtlich, die im Jahr 2024 zum Erliegen gekommenen Flächen wieder ausdehnen zu können“, erläutert Waldenberger
„Dauerbrenner Pflanzenschutz“: Inlandsverbote versus freier Importmöglichkeiten
Für den wirtschaftlichen Anbau kleiner Kulturen ist die ausreichende Verfügbarkeit von Pflanzenschutzverfahren ein essenzieller Erfolgsbaustein. Die Sicherstellung der Anbauwürdigkeit mancher Gemüsearten und damit deren Erhalt ist ein Ziel, das von der Forschung, Beratung und Politik im Sinne der Konsumenten und Produzenten verfolgt werden muss – besonders dann, wenn ein Land seiner Bevölkerung Versorgungssicherheit bieten will. Deshalb plädiert Präsident Waldenberger für EU-weit gleiche Produktionsmöglichkeiten und stärkere Kontrollen von in der EU nicht zugelassenen Pflanzenschutzmittelwirkstoffen bei Importen.
Ein praktisches Beispiel für die Folgen verschärfter Pflanzenschutzregelungen im Lebensmitteleinzelhandel ist die neue Vorgabe für 2025, Radieschen und Kohlrabi ab Sommer vorwiegend ohne Blattgrün anzuliefern. Der Grund: Blätter mit Fraßspuren durch Insekten gelten zunehmend als unzumutbar für Konsumentinnen und Konsumenten.
Kurios mutet das im Vergleich mit Importware an – denn Tomaten an der Rispe oder Zitronen mit Blatt aus südlichen Ländern gelten nach wie vor als attraktives Verkaufsargument, obwohl der Blattbehang hier reinen Marketingzwecken dient. Während heimische Betriebe unter strengeren Regeln wirtschaften, gelangen über Importe weiterhin Produkte in die Regale, die mit in Österreich verbotenen Wirkstoffen behandelt wurden.
„Das ist eine Schieflage, die für viele Gemüsebaubetriebe zur Existenzfrage wird. Unser Appell und die klare Forderung lauten daher: Die EU-PSM-Wirkstoffzulassung und die einhergehende PSM-Anwendung muss mit dem Grundgesetz des freien Warenverkehrs innerhalb der Mitgliedstaaten, zumindest für den kleinkulturigen Gemüseanbau, unverzüglich in Einklang gebracht und die PSM-Gesetzgebung nicht nur harmonisiert, sondern vereinheitlicht werden“, so Waldenberger.
„Gut zu wissen“: Auf die Transparenz der Herkunft kommt es an
Seit 1. September 2023 besteht in der Gemeinschaftsverpflegung eine Verordnung zu verpflichteter Herkunftsangabe bei Speisen, die Fleisch, Milch und Eier enthalten. Das große Umdenken stellt nun die Frage auf, wie man die neuen gesetzlichen Verpflichtungen am einfachsten umsetzen kann. Die Initiative „Gut zu wissen“ der Landwirtschaftskammer Österreich bietet ein einfaches transparentes Herkunftskennzeichnungssystem mit jährlicher Kontrolle durch unabhängige Kontrollstellen.
Das „Gut zu wissen“ Zertifikat erfüllt die Kriterien der Verordnung und ersetzt somit die Kontrolle der Lebensmittelbehörde. Jetzt liegt es auch in den Händen der Gastronomie, auf freiwilliger Basis an der Initiative teilzunehmen, die Herkunft der Lebensmittel anzugeben und sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu sichern.
Anlässlich der heutigen Pressekonferenz fordern wir als Interessensvertretung erneut und vehement auch für die Bereiche Gemüse, Erdäpfel und Obst die verpflichtende Herkunftsangabe insbesondere bei „VERABEITETEN“ Produkten. Unser Seminarhaus auf der Gugl hat die Initiative „Gut zu wissen“ von Beginn an umgesetzt und geht hier auch beim Gemüse als Vorbild voran.
„Eiskalte Preispolitik“: Aktionsverkäufe und Eigenmarkenanteile nehmen weiter zu
Im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel gibt es kaum noch einen Tag ohne Rabattaktionen. Ob „Joker“, „Extrem-Aktion“ oder „Fette Beute“ – Konsumentinnen und Konsumenten können nahezu täglich mindestens 25 Prozent auf Lebensmittel sparen. Bei Frischgemüse entwickelt sich der Aktionsanteil je nach Gemüseart unterschiedlich und variiert im Jahr 2024 zwischen 16 und 30 Prozent.
Doch was für viele wie ein Vorteil wirkt, hat eine Schattenseite: Der Anteil solcher Aktionen steigt stetig – zulasten der heimischen Wertschöpfung. Laut Daten der Agrarmarkt Austria hat sich der wertmäßige Anteil von Aktionsverkäufen seit 2003 mehr als verdreifacht und lag 2024 bereits bei 32,4 Prozent. „Diese eiskalte Preispolitik untergräbt langfristig die Existenz vieler landwirtschaftlicher Betriebe“, ist Waldenberger überzeugt.
OÖ Gemüse steht für regionale Vielfalt, vielseitigen Vertrieb und ökologische Produktion
Oberösterreichs Stärke im Gemüsebau liegt in der Vielfalt: Zahlreiche Kulturen werden für die regionale Vermarktung und saisonale Verarbeitung angebaut. Doch mit durchschnittlich nur knapp zwölf Hektar Anbaufläche pro Betrieb ist die Struktur im internationalen Vergleich – etwa mit Spanien, Italien oder Polen – kleinräumig. Daraus resultieren Kosten und auch Handelsnachteile bei der Vermarktung an große, überregionale Abnehmer.
„Unsere Betriebe sind stark, wenn es um Vielfalt und Qualität geht, aber im Wettbewerb mit Großproduzenten stoßen sie rasch an wirtschaftliche Grenzen, weil geforderte Aktionsrabatte nicht gewährt werden und die gewünschten Volumina nicht auf wenigen Schlägen produziert werden können“, erläutert Landesrätin Michaela Langer-Weninger.
Pro-Kopf-Verbrauch: Gemüse nimmt 2024 leicht zu, Erdäpfel und Obst stagnieren
Es gibt zwar keine Detaildaten für OÖ, jedoch zeigt eine Grafik der Statistik Austria den steigenden Trend des Gemüsekonsums in Österreich seit 1995 und damit aus Sicht der Gemüsebauern eine erfreuliche Entwicklung bis 2022. Schlechte Ernteerträge und rückläufige Anbauflächen ließen diesen Aufwärtstrend im Jahr 2023 stark einbrechen, jedoch besteht für 2025 durch die österreichweite Zunahme der Gemüseanbaufläche um 633 Hektar (+ 3,8 Prozent), davon 111 Hektar in OÖ (+ 5,7 Prozent) die Hoffnung, dass sich der langfristige Trend zur pflanzlichen Ernährung im Sinne der Gemüsebauern fortsetzt.
Hohe Investitionen in moderne Anbau-, Pflege- und Erntemaschinen, Bewässerungstechnik, Kühlung und Lagerung sowie Mitarbeiterwohnungen, etc. können sich nur durch faire Handelsbeziehungen (Einhaltung von Abnahmezusagen) und kostendeckende Erzeugerpreise amortisieren. Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, liegt der Selbstversorgungsgrad im Durchschnitt (ohne die Haus- und Kleingärtenproduktion) nur bei 52 Prozent und viele auch in Österreich problemlos kultivierbare Gemüsearten werden zu einem hohen Anteil importiert.
„Die Sicherung unseres Selbstversorgungsgrades bei Gemüse, Erdäpfeln und Obst ist eine zentrale Zukunftsfrage. Der heimische Gemüseverbrauch steigt seit Jahrzehnten, und die Nachfrage nach regionaler Herkunft nimmt stetig zu – doch gleichzeitig konnten wir 2023/24 nur 52 Prozent des Bedarfs aus österreichischer Produktion decken. Bei Erdäpfeln lag der Wert zuletzt bei 78 Prozent, bei Obst sogar nur bei 40 Prozent. Diese Entwicklung zeigt klar, dass wir unsere Versorgungssicherheit nicht als selbstverständlich ansehen dürfen. Unsere Gemüsebäuerinnen und –bauern erweitern laufend ihr Angebot, bereichern unsere heimische Kulinarik und treffen die Wünsche der Konsumentinnen und Konsumenten zielgenau. Umso wichtiger ist es auch uns als Land OÖ für entsprechende zielgerichtete Unterstützungsmaßnahmen zu sorgen“, erläutert Langer-Weninger.
OÖ Gemüsebauern sichern und bieten Arbeitsplätze
Die oberösterreichischen Gemüsebaubetriebe sichern ca. 800 familieneigene Arbeitsplätze und beschäftigen zusätzlich rund 1.000 Arbeitnehmer ganzjährig. Sie sichern in den nachgelagerten Bereichen der heimischen Wirtschaft sowie am Dienstleistungssektor weitere rund 1.500 Arbeitsplätze.
Weltweit ist der handarbeitsintensive Gemüseanbau auf ausländische Saisonarbeiter und Erntehelfer angewiesen. In Oberösterreich stammen diese hauptsächlich aus den Ländern Ukraine, Kosovo, Albanien und Rumänien. Mittlerweile kommen aber auch schon ca. 100 Personen aus Vietnam.
In OÖ werden von allen landwirtschaftlichen Sektoren (vorwiegend Gemüsebau, Obstbau und Baumschulen) gemeinsam rund 5.000 Beschäftigungsverhältnisse mit Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeitern pro Jahr abgeschlossen. Davon entfallen rund 3.800 Anstellungen auf Nicht-EU-Bürger und rund 1.200 Anstellungen auf EU-Bürger.
Von den Nicht-EU-Bürgern sind circa 2.000 Personen aus der Ukraine. Durch die 2022 eingeführte Stammmitarbeiterregelung und dem in Folge möglichen Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Karte konnten bereits circa 1.400 Stammmitarbeiter registriert und somit das Kontingent entlastet werden.
Auch im vierten Jahr seit Beginn des Ukrainekrieges kommen viele, hauptsächlich weibliche Saisonarbeitskräfte verlässlich nach Oberösterreich. Seit 2023 ist der Arbeitsmarkt für registrierte ukrainische Flüchtlinge ohne separate Beschäftigungsbewilligung auch für erstmalig nach Österreich kommende Personen zugänglich.
Aufgrund der Nicht-Anrechnung der registrierten ukrainischen Flüchtlinge kann mit dem für 2025 erlassenen Drittstaatskontingent von 1.526 Plätzen für sonstige Drittstaatsangehörige während der Hauptsaison von April bis September das Auslangen gefunden werden.
Der Gemüsebau in Oberösterreich braucht einfache und pragmatische Lösungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt. In diesem Zusammenhang fordert der oberösterreichische Gemüsebau die Abschaffung der sogenannten „Ersatzkraftprüfung“, welche nach Beantragung durch den Landwirt und vor Ausstellung einer Beschäftigungsbewilligung derzeit vorgeschrieben ist. Das zuständige AMS ist angehalten, zwei Wochen lang vorgemerkte Leistungsbezieher (Arbeitslose, Asylwerber, …) auf diesen Arbeitsplatz zu vermitteln.
Dies entspricht einerseits einer bürokratischen Hürde ohne Aussicht auf Erfolg und bedeutet vor allem einen enormen Zeitverlust auf dem Antragsweg für frühe Erntekulturen wie zum Beispiel Radieschen und Salate.
Arbeitskosten bestimmen den Produktionsstandort und damit die Herkunft
Neben Einlegegurken, Spargel und Obst zählen auch sehr viele Frischgemüsearten zu den handarbeitsintensiven Kulturen. Das sind z. B.: Bundzwiebel, Broccoli, Chinakohl, Kohlrabi, Kraut, Karfiol, Kürbisse, Knoblauch, Radieschen, Rote Rüben, Porree, Kräuter, Salate, Stangensellerie, Süßkartoffel, Zucchini, Zuckermais etc. sowie Gurken, Paprika und Tomaten. Die Verfügbarkeit von Arbeitskräften zu wettbewerbsfähigen Konditionen ist bei handarbeitsintensiven Kulturen entscheidend für den Produktions-Standort. Dies bedeutet im Umkehrschluss: Hohe Lohnnebenkosten fördern den Import.
Mit der Nachbarschaft zu Bayern hat OÖ schon immer eine spezielle „Konkurrenzsituation“ zu Deutschland sowohl am Markt als auch bei den Arbeitskräften. So hat seit dem EU-Beitritt Österreichs beispielsweise bei Einlegegurken der hohe Wettbewerbsvorteil des lohnnebenkostenfreien „70 Tage-Modelles“ in Deutschland den OÖ Marktanteil im LEH von über 80 Prozent auf rund 45 Prozent sinken lassen.
Auch bei Frischgemüse, wie z.B. frischem Spargel, hat Deutschland trotz ähnlicher klimatischer Bedingungen eine Selbstversorgung von circa 85 Prozent aufbauen können, während in Österreich letztes Jahr circa 58 Prozent des Verbrauches importiert wurden.
Seit 1. Jänner 2025 beträgt der Mindestlohn in Deutschland 12,82 Euro pro Stunde, der kollektivvertragliche Nettolohn in OÖ liegt für Saisonarbeiter heuer netto bei 8,66 pro Stunde (brutto 1.800 Euro pro Monat) – dies bedeutet für Saisonarbeiter in OÖ weiterhin einen Auszahlungsnachteil von circa vier Euro pro Stunde.
Für die Arbeitgeber in OÖ erwachsen hingegen ab der ersten Beschäftigungsminute Gesamtbruttokosten pro Arbeitsstunde von 18,10 Euro, was gegenüber den deutschen Arbeitgebern Mehrkosten von mehr als fünf Euro pro Stunde ausmacht. Beispiel: Auf einem Hektar Salat mit einem Arbeitskraftbedarf von circa 800 Stunden pro Hektar bedeutet dies einen Kostennachteil von mindestens 4.000 Euro pro Hektar. Noch viel eklatanter ist der Wettbewerbsnachteil z.B. bei Kraut, Sellerie und Porree gegenüber der Herkunft Polen oder Slowenien.
„Forderung aufrecht“: Lohnnebenkosten senken
„Wir brauchen für die handarbeitsintensiven Kulturen in OÖ dringend eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und eine Senkung der Lohnnebenkosten. Es muss alles getan werden, um die erforderlichen bäuerlichen Strukturen auch für eine Belieferung des österreichischen LEHs aufrecht zu erhalten bzw. für Jungübernehmer zu schaffen. Nur wenn eine entsprechende dauerhafte Eigenversorgung mit frischem Gemüse und Obst erreicht wird, ist man unabhängig von Importen aus aller Welt mit vielfach unbekannten Produktionsstandards“, plädiert Langer-Weninger.
„Fresh-Cut, Halbfertigprodukte oder Convenience“ – von der Nische zum Trend
„Die Komplexität unseres Tagesablaufes erfordert immer häufiger, außer Haus zu essen bzw. es bleibt immer weniger Zeit, aufwändig und selbstständig im Haushalt zu kochen. In rund 3.000 österreichischen Gemeinschaftsverpflegungsbetrieben wie zum Beispiel in Großbetrieben, Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen und Altenheimen werden circa 2,2 Millionen Mahlzeiten täglich zubereitet und muss zunehmend bei Personalkosten gespart werden. Daher geht auch beim Gemüse-Vertrieb der Trend zunehmend in Richtung Convenience-Produkte“, erläutert Ewald Mayr, Obmann von GEO_OÖ, dem Verband der OÖ Gemüse-, Erdäpfel- und Obstbauern.
Untenstehend der Betrieb Hofer aus Hartkirchen vorgestellt, welcher als ursprünglicher Direktvermarkter begann, Gemüse, Erdäpfel und Obst in „vorbereiteter“ Form (gewaschen, geschält, geschnitten, gekocht, gemischt, …) und in vereinbarter Menge bzw. Gebindegröße zuzustellen. Diese Form der Gemüsevermarktung hat einige Besonderheiten, die hier gezeigt werden sollen.
Segmententwicklung Frischgemüse im Lebensmitteleinzelhandel 2020 - 2024
Die Haushaltseinkäufe bei Frischgemüse im Lebensmitteleinzelhandel betrugen im Jahr 2024 laut AMA-Marketing in Summe Euro 888,68 Millionen (238,55 Tonnen an Menge). Davon entfiel der Hauptanteil auf Fruchtgemüse wie zum Beispiel Tomaten, Gurken, etc. mit 45,4 Prozent. Blattgemüse (dem Hauptsegment und Hauptbestandteil bei vorbereitetem Gemüse) machte hier nur lediglich 14 Prozent aus und das restliche Gemüse zusammen nur 40,6 Prozent.
Von den gesamten Frischgemüseeinkäufen 2024 macht der Anteil für vorbereitetes Frischgemüse in Summe Euro 73,99 Millionen oder 8,33 Prozent aus. Wenn man wiederum die Gruppe der „Blattgemüse/vorbereitet“ näher betrachtet, so ergibt das einen Wert von 30,16 Millionen Euro oder 40,75 Prozent von der gesamten Haushaltsausgaben für vorbereitetes Frischgemüse.
Nach eigenen Erhebungen bei den drei größten Erzeugern von Frische Convenience-Produkten (Firma Vitana, Firma Eisberg, Firma Wiegert) in Österreich werden demnach circa 14 Prozent oder circa 230 Hektar der gesamten Fläche an Salatgewächsen in Österreich (2024: 1.636 Hektar) für vorbereitetes Blattgemüse verwendet, wobei laut Firmenangaben je nach Saison davon auch nennenswerte Menge in den Export (hauptsächlich nach Deutschland) vermarktet werden.
Neue EU-Vermarktungsnorm und AMA-Gütesiegel können Herkunft Österreich stärken
Betrachtet man die Entwicklung zurück bis ins Jahr 2018 lässt sich allerdings nüchtern feststellen, dass es in den letzten sieben Jahren keine nennenswerten Steigerungen bei der Absatzmenge gegeben hat, obwohl die genannten drei großen Firmen hohe Investitionen in modernste Technologie, Produktforschung und Marketing getätigt haben. Auch die OÖ Gemüsebauern haben vielfach ihr Sortenspektrum, ihre Logistik und das Zeitmanagement am Betrieb an höhere Absatzmengen geknüpft.
„Seit 1. Jänner 2025 gilt die neue EU-Vermarktungsnorm für Obst und Gemüse (2023/2429). In dieser ist erstmals geregelt, dass auch bei „geschnittenen“ (nicht verarbeiteten) Produkten das Ursprungsland verpflichtend zu kennzeichnen ist. Häufig wird dies im Rahmen des Aufdruckes zum Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) angegeben: Wenn ein Produkt nur aus einer Zutat besteht, das konkrete Herkunftsland – wenn ein Produkt aus mehreren Zutaten, aber alle aus der EU besteht, mit Herkunft „EU“. Produkte mit rein österreichischen Zutaten haben nun die Chance sich beispielsweise mit einer Auslobung AMA-Gütesiegel bzw. AMA-Bio-Siegel von Billiglohnländern wie Polen und Ungarn abzuheben“, begrüßt Obmann Mayr.
Weitere Informationen.
Quelle: AIZ.info
Veröffentlichungsdatum: 08.05.2025
Peru: Midagri organisiert im Mai das 1. Internationale Himbeerforum


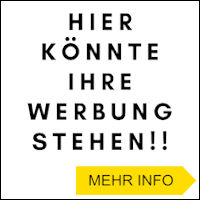

.JPG)