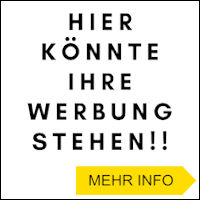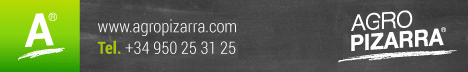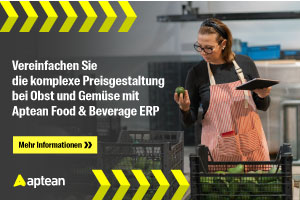LWK Niedersachsen: Profi-Tag Gemüsebau - Rekord-Beteiligung und innovative Impulse für die Branche
Der Profi-Tag Gemüsebau der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK), eine der wichtigsten Fachveranstaltungen für die Gemüsebranche des Bundeslandes, verzeichnete in diesem Jahr eine Rekord-Beteiligung: Mit 185 Personen konnten Gartenbau-Geschäftsbereichsleiter Prof. Dr. Bernhard Beßler und Dr. Hendrik Führs, Leiter des Fachbereichs Beratung und Qualitätsmanagement im Gartenbau, im LWK-Tagungszentrum in Hannover-Ahlem so viele Gäste zum Profi-Tag begrüßen wie noch nie.
„Profi-Tag“: Mit 185 Gästen erreichte der Profi-Tag Gemüsebau 2025 der Landwirtschaftskammer Niedersachsen am 18.11.2025 in Hannover-Ahlem eine Rekord-Beteiligung. (Foto © LWK Niedersachsen / Erich Klug)
Neben erfahrenen Gemüsegärtnerinnen und -gärtnern nahmen auch zahlreiche junge Nachwuchskräfte sowie Auszubildende aus der Justus-von-Liebig-Schule teil – ein deutliches Zeichen für den laufenden Generationswechsel in der Branche.
Pflanzenschutz-Vortrag mit Tradition und neuem Gesicht
Den Auftakt der Veranstaltung bildete ein aus den Vorjahren bereits fest etablierter Vortrag zur aktuellen Pflanzenschutz-Zulassungssituation im Gemüsebau.
Fachkompetenz im Pflanzenschutzamt. (Foto © LWK Niedersachsen / Erich Klug)
In diesem Jahr jedoch mit neuem Gesicht: Selina Plorin, die die Nachfolge von Ulrike Weier angetreten hat, schilderte eindrücklich, wie der Wegfall zahlreicher Pflanzenschutzmittel zu einem enormen Anstieg der Notfallzulassungen geführt hat: Insgesamt 45 solcher Fälle seien allein in dieser Saison bearbeitet worden.
Der Schwerpunkt habe hierbei in der Bekämpfung von falschem Mehltau und saugenden Insekten gelegen.
Plorin beendete ihren Vortrag mit einem Blick in die Praxis, indem sie unterschiedliche Möglichkeiten für eine Pflanzenschutzstrategie zur Bekämpfung von Blattläusen im Salat vorstellte – ein Thema, welches vielen Betrieben seit der Absenkung der Rückstandshöchstgehalte für Acetamiprid-haltige Mittel Bauchschmerzen bereitet.
„Gemüsebau“: Aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen im niedersächsischen Gemüsebau (im Bild: Möhrenernte auf einem Betrieb im Kreis Diepholz) stehen im Mittelpunkt des Profi-Tages Gemüsebau der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. 2025 ging es in Vorträgen und Diskussionen unter anderem um Pflanzenschutz, Schaderreger und digitale Technologien. (Archivfoto: © LWK Niedersachsen / Wolfgang Ehrecke)
Erdmandelgras und Schilf-Glasflügelzikade – zwei Endgegner für den Gemüsebau?
Die nächsten beiden Vorträge beschäftigten sich mit großen Herausforderungen auch für den Gemüsebau. Zunächst stellte LWK-Beikrautexperte Maximilian Koppel das Erdmandelgras vor.
Er ging dabei auf die Herkunft, den Lebenszyklus und die Verbreitung in Niedersachsen ein und erläuterte, dass insbesondere die Rhizome und Erdmandeln erheblich zur Verbreitung beitragen und die Samen nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Die gründliche Reinigung der eingesetzten Maschinen nach jedem Ernte-Einsatz gelte daher als wichtige Bekämpfungsstrategie, um eine weitere Ausbreitung des Erdmandelgrases zu verhindern.
Je nach Stärke des Befalls gebe es die Möglichkeit, Einzelpflanzen auszukoffern und zu entsorgen oder die gesamte Fläche als Schwarzbrache aus der Produktion zu nehmen und mit Herbiziden zu behandeln.
Unkrautmanagement. (Foto © LWK Niedersachsen / Erich Klug)
Der Druck durch dieses Ungras sei hoch, die Bekämpfung extrem schwierig. Wichtigstes Fazit, welchem sich auch einige Gäste mit ihren Erfahrungen anschlossen: Das Erdmandelgras sollte auf keinen Fall unterschätzt werden.
Dr. Florian Wulf, im LWK-Pflanzenschutzamt Sachgebietsleiter Gemüse und Obstbau, ging auf das Thema Schilf-Glasflügelzikade ein. Sein Fazit: Der Erfahrungsschatz mit der Schilf-Glasflügelzikade in Gemüsekulturen sei noch sehr klein.
Der Schaden durch die Zikade selbst sei nicht das Problem, sondern deren Eigenschaft, Pflanzenkrankheiten wie Stolbur und Arsenophonus zu übertragen. Diese zeigten sich in Wurzelgemüsen in Form von „Gummirüben“ und könnten hohe Ertragseinbußen zur Folge haben.
Neben einigen wenigen, inzwischen zugelassenen Pflanzenschutzmitteln spielten auch hier die Schwarzbrache und sauberes Pflanzgut (Spargel und Rhabarber) eine Rolle in der Bekämpfungsstrategie. Wichtiger Baustein sei zudem das bundesweite Monitoring.

Wer schreibt, der bleibt – Aufzeichnungspflichten im Pflanzenschutz
Zum Thema Aufzeichnungspflichten stellte Dr. Wulf den aktuellen gesetzlichen Rahmen vor. Dabei wurde schnell klar, dass viele Dinge noch unklar sind.
Die Aufzeichnungspflichten würden erweitert und müssten perspektivisch digital vorgenommen werden.
Dazu wurde das System „PS Info – Mein Betrieb“ vorgestellt, welches für Betriebe ohne Ackerschlagkartei eine gute Lösung sein kann.
Von Lasern und Spot-Sprayern: Zukunftsperspektiven im Gemüse
Der nächste Themenblock beschäftigte sich mit potentiellen Lösungsansätzen für die Herausforderungen im Bereich des Pflanzenschutzes und insbesondere des Unkrautmanagements.
Neue technische Entwicklungen wie das Spot-Spraying beziehungsweise Spot-Dropping sowie Lasertechnik gegen Unkraut wurden vorgestellt, die Vor- und Nachteile beleuchtet und die Einsatzmöglichkeiten in der Praxis aufgezeigt.
Arne Lüders vom Feldroboter-Hersteller Kilter und Frank Uwihs vom Landhandelsunternehmen Agravis stellten Technologien vor, die Herbizide mittels Sprühstoß oder Tropfen sehr gezielt ausbringen können.
Das solle letztlich eine Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes um 70 bis 80 Prozent ermöglichen. Die gezielte Ansteuerung der Unkräuter erfolge mittels Echtzeit-Bildverarbeitung und KI.
Da es pro Kultur etwa 1.500 Bilder brauche, um die KI in passendem Maße zu trainieren, seien diese Technologien noch nicht für alle Gemüsekulturen verfügbar. Die Ausweitung auf weitere Kulturen schreite jedoch schnell voran.
Dr. Merve Wollweber. (Foto © LWK Niedersachsen / Erich Klug)
Dr. Merve Wollweber vom Laserzentrum in Hannover stellte unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von Lasern im Gemüsebau vor und gab zugleich einen guten Überblick über die technischen Aspekte und die Arbeitssicherheit im Umgang mit dieser Technologie.
Eindrückliche Videos veranschaulichten die Wirksamkeit, insbesondere bei kleinen Unkräutern. Wie auch die gezielte Ausbringungstechnik von Pflanzenschutzmitteln arbeitet die Lasertechnologie mit der Bilderkennung und Bildverarbeitung mittels KI.
Hersteller-Angaben nicht immer mit Praxis-Erfahrungen deckungsgleich
Das Feld der Lasertechnik zur Unkrautbekämpfung entwickelt sich rasant – zahlreiche Anbieter steigen laufend in den Markt ein. Dr. Wollweber betonte, dass auf die Aspekte Praxistauglichkeit, Wirtschaftlichkeit des Einsatzes sowie Anwenderschutz besonderes Augenmerk gelegt werden müsse.
Die Angaben der Hersteller bezögen sich oft auf einen optimalen Zustand, der so in der Realität nicht immer anzutreffen sei.
Dieser Einschätzung schloss sich Christoph Werner vom Betrieb Mählmann Gemüsebau an. In seinem Vortrag schilderte Werner eindrücklich die Erfahrungen der Praxis mit den neuen Technologien.
Sobald das Unkraut schon zu groß sei oder Steine in der Fahrgasse lägen, es zu Abnutzungen oder Fehlern komme, verringere sich die Hektarleistung dieser neuen Technologien – sowohl bei Lasern als auch beim Spot/Drip-Spraying – sehr schnell.
Zusätzlich zu den hohen Anschaffungskosten erschwere dies den wirtschaftlichen Einsatz. Manchmal brauche es erst ein intensives Einarbeiten und Ausprobieren, bis Maschine, Betriebsabläufe und Anwender/-innen so aufeinander abgestimmt seien, dass es laufe – dann könne sich die Investition in eine neue Technik trotz hoher Kosten wirtschaftlich lohnen.
Mit Vorträgen zu Düngung, Bewässerung, Gemüsemarkt und Torfersatz wurde die Themenvielfalt im weiteren Verlauf des Profi-Tags Gemüsebau immer breiter.
Mit Blick auf Lachgasemissionen, die im Zusammenhang mit der gewählten Dünge-Strategie und der Einarbeitung von Ernteresten recht unterschiedlich hoch ausfallen können, ging Dr. Carsten Vorsatz von Mählmann Gemüsebau auf Ergebnisse ein, die in Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück entstanden sind.
Eindrucksvoll zeigte er große Einsparungspotentiale auf. Die Frage im Titel seines Vortrages: „Haben wir 120 Jahre falsch gedüngt?“ wurde im Vortrag mit „nein“ beantwortet – wir wussten es ja nicht besser. Und auch heute besteht in diesem Bereich noch Forschungsbedarf.
Bezüglich der Zukunft der Bewässerung im Gemüsebau stellte Clemens Löbnitz, Geschäftsführer des Kreisverbands der Wasser- und Bodenverbände Uelzen, zum einen den hohen Aufwand bei der Erstellung von hydrogeologischen Modellen für Wasserrechtsverfahren vor. Zum anderen berichtete er von vielen innovativen Lösungsansätzen, wie zukünftig die Entnahme aus dem Grundwasser ergänzt werden könnte.
Beispiele von Wasserspeicherung aus Industrie und Oberflächengewässern, Grundwasseranreicherung und regelbare Drainagen stellten Chancen und Herausforderungen dar.
Um diese langwierigen und kostspieligen Verfahren und Investitionen besser anschieben zu können, warb Löbnitz für die Gründung eines entsprechenden Verbandes.
Schwierige Aussichten am deutschen Gemüsemarkt
Michael Koch von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) verdeutlichte in seinen Vortrag zur Preisentwicklung des Gemüsemarkts anhand mehrerer Beispiele und Grafiken, dass die gesamtwirtschaftliche Lage und die Verbraucherstimmung weiterhin eine Herausforderung für den Verkauf von Gemüse sind.
Vom zurückhaltenden Konsumklima sei insbesondere die Gastronomiebranche betroffen, mit direkten Folgen für den Gemüsemarkt.
Die Preise an den Erzeugermärkten seien leicht gestiegen, aber die Betriebsmittelpreise und Lohnkosten ebenfalls, fuhr Koch fort.
Die Gemüseeinkaufe je Haushalt seien gleichgeblieben. Der Anteil des Bio-Gemüses sei nach einem Rückgang wieder auf dem Ausgangsniveau.
Die Produktion von Obst und Gemüse in Deutschland werde immer teurer und schwieriger, gleichzeitig solle jedoch die nationale und regionale Produktion gestärkt werden – ein Gegensatz, der noch aufzulösen sei.
Torfersatz: Für kompletten Umstieg fehlen noch Alternativen in geeigneter Qualität
Zum Abschluss des Profitages Gemüse 2025 präsentierte Philip Gerke von der LWK-Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau seine Ergebnisse aus Versuchen zum Torfersatz und zur Umstellung auf Torfersatz im Gemüsebau.
Er schlussfolgerte, dass eine komplette Substitution pflanzenbaulich zurzeit noch nicht möglich ist. Die größte Hürde bilde die Verfügbarkeit von Ersatzprodukten in geeigneter Qualität.
Veröffentlichungsdatum: 26.11.2025