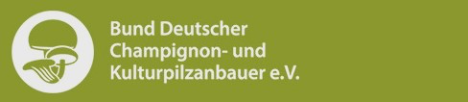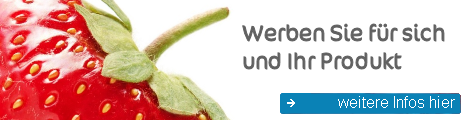BDC: GEPC-Jahrestagung 2025 - Rückstandshöchstgehalte und Torfersatzstoffe
Potenzielle Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Stroh sind ein aktuelles Thema für die europäischen Pilzproduzenten. Ebenso die Suche nach Torfersatzstoffen für die Deckerden. BDC-Repräsentantin Susanne R. Knobloch war auf der Jahrestagung der Vertretung der europäischen Pilzproduzenten (GEPC) am 21. Mai 2025 in Warschau dabei.

Foto © BDC
Phosphonsäure-Einträge und Höchstgehalte im Fokus
Seit dem 29. April 2025 gilt die EU-Verordnung 2024/2619 zur Änderung der Rückstandhöchstgehalte von Fosetyl, Kaliumphosphonat und Dinatriumphosphonat.
Die Verordnung legt unter anderem die Rückstandshöchstgehalte für „Phosphonsäure und ihre Salze“ in Lebensmitteln fest. Für Kulturspeisepilze beträgt dieser Wert 1,5 mg/kg.
Aktuell ist in der EU kein Pflanzenschutzmittel mit Phosphonsäure für den Pilzanbau zugelassen. Mögliche Rückstände können jedoch auf behandelten Weizen und damit auf Stroh zurückzuführen sein, das zur Herstellung des Pilz-Kultursubstrats verwendet wird.
In einer Mitteilung vom 1. August 2025 informiert der GEPC darüber, dass es derzeit in den Mitgliedstaaten nur sehr wenige Pflanzenschutzmittel gibt, die „Phosphonsäure und ihre Salze“ enthalten und für Weizen zugelassen sind.
Aufgrund ihrer Ungiftigkeit und ihrer Eignung als Ersatz für herkömmliche Pflanzenschutzmittel würden sie jedoch wahrscheinlich häufiger von Landwirten im Weizenanbau eingesetzt werden.
Zudem könne Phosphonsäure auch aus anderen Quellen stammen, bei denen Kaliumphosphonate und Dinatriumphosphonate abgebaut werden.
Dazu zählen unter anderem Düngemittel, Pflanzenstärkungsmittel, Gülle und Bodenverbesserungsmittel. Zudem gebe es ein „Grundrauschen“ aus den Böden, das zum Nachweis von „Phosphonsäure und ihren Salzen“ in unbehandeltem Weizen führen könne.
Bei mehr als 100 Analysen wurde durchschnittlich 0,037 mg/kg beziehungsweise 0,003 mg/kg für konventionelles und biologisches Weizenkorn festgestellt.
Der GEPC verfolgt aktuell weiterhin die für den Weizenanbau in den Mitgliedstaaten zugelassenen Pflanzenschutzmittel mit Phosphonsäure. Zudem stellt er Analysen zu Phosphonsäure-Rückständen in Zuchtpilzen zusammen.
Ziel ist eine Prüfung, ob der entsprechende Rückstandshöchstgehalt angemessen ist.
Versuch zur Übertragung von Phosphonsäure
Um Informationen über mögliche Einträge zu erhalten, führte der niederländische Substratanbieter CNC Grondstoffen einen Versuch zur Übertragung von Phosphonsäure durch.
Den Ergebnissen zufolge kann es zur Überschreitung des Rückstandshöchstgehalts für Kultur-Speisepilze kommen, wenn Produkte, die diese Wirkstoffe enthalten, in großem Umfang beim Anbau von Weizen eingesetzt werden.
Dies sei besonders kritisch hinsichtlich der ökologischen Pilzproduktion.
Aktueller Stand zu Chlormequat
Ein aktuell durchgeführter Versuch dient der Untermauerung des vorläufigen Chlormequat-Rückstandshöchstgehalt-Wertes. Die Durchführung erfolgt wie der Mepiquat-Versuch von Johan Baars von CNC Grondstoffen. Auch der BDC beteiligt sich an den Kosten des Versuchs.
Die EU-Kommission hat ihre vorgeschlagenen vorübergehenden Rückstandshöchstgehalte für Chlormequat in und auf Zuchtpilzen sowie den vorgeschlagenen Zeitplan für die Überprüfung vorgestellt, mit einem spezifischen Wert für Austernpilze.
Ebenso legte sie ihren Vorschlag für einen Rückstandshöchstgehalt-Wert für 1,4-Dimethylnaphthalin für andere pflanzliche Erzeugnisse als Kartoffeln und einen Zeitplan für diese Überprüfung vor.
Die Mitgliedstaaten waren aufgefordert worden, ihre Stellungnahmen bis zum 14. März 2025 zu übermitteln. Das Ergebnis steht noch aus.
Start des EU-kofinanzierten Projektes „Peatless“
Bei dem Treffen in Warschau stellte die GEPC das EU-kofinanzierte Projekt „Peatless“ vor. Das Projekt wird mit 4,2 Millionen Euro aus dem Programm „Horizont Europa“ und dem Schweizer Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) finanziert. Die Laufzeit ist für drei Jahre angesetzt, von Mai 2025 bis April 2028.
In dem Konsortium sind insgesamt 13 Partner aus Spanien, Italien, Belgien und der Schweiz vertreten, unter anderem Forschungsinstitute, Universitäten, Akteure aus der Industrie, Erzeuger und politische Entscheidungsträger. Das Technologische Forschungszentrum für Champignons (Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón, CTICH) im spanischen La Rioja koordiniert das Projekt.
Die Initiative will den Einsatz torfarmer Substratmischungen in drei wichtigen Gartenbausystemen – neben der Pilzzucht auch in Jungpflanzen und Zierpflanzen – in vier großen Gartenbauregionen Europas demonstrieren.
Getestet werden die Mischungen in kommerziellen Einrichtungen in La Rioja, in Pistoia in Italien, im belgischen Flandern sowie in Seeland in der Schweiz.
Ein dafür entwickeltes digitales Überwachungssystem soll die Wirkung zeigen und die Entscheidungsfindung unterstützen. Darüber hinaus will das Projekt Innovation und Bildung durch Wissensaustausch fördern, um das Vertrauen der Gartenbau-Akteure in Torfalternativen zu stärken.
Neu geschaffene Geschäfts- und Organisationsmodelle sollen die großflächige Einführung durch die Gartenbauindustrie unterstützen. Ziel ist, die Abhängigkeit von Torf zu reduzieren.
Das nächste Treffen des GEPC´s in Präsenz wird 2026 in Ungarn stattfinden.
Quelle: BDC
Veröffentlichungsdatum: 18. September 2025